Die EU-Abfallrahmenrichtlinie legt Maßnahmen für einen „nachhaltigeren und weniger Abfall produzierenden Textilsektor“ fest, mit denen die übermäßige Erzeugung von Textilabfällen und die Praktiken der sog. Ultra Fast Fashion bekämpft werden sollen. Das soll verhindern, dass Textilerzeugnisse weggeworfen werden, bevor sie ihre potenzielle Lebensdauer erreicht haben.
Die neuen Regeln sehen harmonisierte Vorgaben für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) vor:
- Hersteller müssen künftig eine Gebühr zur Finanzierung der Abfallsammlung und -behandlung entrichten.
- Die Mitgliedstaaten können die von den Herstellern zu entrichtenden Gebühren entsprechend der Nutzungsdauer der Textilerzeugnisse und ihrer Haltbarkeit anpassen.
Die Verpflichtung gilt für alle Hersteller. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands sollen Kleinstunternehmen nach Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung ein weiteres Jahr Zeit bekommen, ihren EPR-Verpflichtungen nachzukommen (insgesamt 3,5 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Vorschriften).
Erste Bewertung
Fast Fashion- und Ultra Fast Fashion-Modelle haben dem deutschen und europäischen Modemarkt schweren Schaden zugefügt. Billige Wegwerfmode überschwemmt seit Jahrzehnten den Markt, während die Hersteller wertiger, langlebiger und nachhaltig hergestellter Produkte Marktanteile verlieren. Die Fast Fashion konnte bislang die Kosten von Umweltschädigung, niedrigen Sozialstandards und Ressourcenverschwendung externalisieren. Das Angebot langlebiger Qualitätsprodukte zu belohnen und die Ressourcenverschwendung schlechter zu stellen, ist daher grundsätzlich eine gute Idee.
Entscheidend ist, ob eine unbürokratische Umsetzung gelingt. Wenn mittelständische Hersteller gezwungen werden, die Lebensdauer ihrer Produkte in umfänglicher Berichterstattung herzuleiten, um hohen Gebühren zu entgehen, und wenn Normen zur Haltbarkeit und Reparierbarkeit selbst einfacher Unterhöschen aufgestellt werden – dann hat die Richtlinie versagt, denn dann bestraft sie die Falschen.
Wie so oft in der europäischen und deutschen Gesetzgebung würden große Player und die Einförmigkeit einfacher Massenware belohnt. Ein Versagen droht auch seitens der Mitgliedstaaten, die Unternehmen wie Verbraucher bereits heute mit nationalen Regelungen zur Herstellerverantwortung drangsalieren. Wird der Flickenteppich jetzt noch bunter und unübersichtlicher, dann stimmt etwas nicht in Europa.
Die Haltbarkeit und Lebensdauer eines Produkts, auch dessen Umweltfußabdruck insgesamt, hängen maßgeblich vom Verbraucher ab: Wie und wie oft wird ein Produkt verwendet, wie und wie oft wird es gewaschen? Hersteller können hierzu Empfehlungen geben, haben es aber nicht in der Hand, wie Kundinnen und Kunden ein Produkt nutzen. Auch wenn es heutzutage fast vermessen klingt: Das soll auch so bleiben!
Hersteller können Empfehlungen geben, doch es liegt in der Hand von Kundinnen und Kunden, wie sie ein Produkt nutzen. Das soll auch so bleiben! Ja, Verbraucher sollen weiterhin die Freiheit haben, Textilprodukte nach ihren Präferenzen zu nutzen.
Wer bei der Gartenarbeit gerne eine Seidenbluse trägt oder seine Handtücher einfach gerne heißer wäscht als vom Hersteller empfohlen, soll sich keine Sorgen machen müssen. Eine solche Freiheit kann es jedoch mit einer überzogenen und bürokratisierten Herstellerverantwortung nicht mehr geben. Gleiches gilt für die Reparierbarkeit von Produkten: Lässt man den Hersteller freie Hand, könnten sich hier fantastische neue Märkte herausbilden. Mit Dienstleistungen ließe sich auch Kundenbindung betreiben. Wird die Regulierung zu weit getrieben, folgt der gefürchtete Reparaturzwang bei der Unterhose. Wirtschaftlichkeit, technische Machbarkeit und eben auch die Freiheit des Verbrauchers sind wichtige Eckpfeiler, um die Reparierbarkeit von Produkten zum Erfolgsmodell zu machen.
Die Einigung im Trilog muss nun noch von EU-Parlament und EU-Ministerrat offiziell angenommen werden. Die Pressemeldung des Rates finden Sie hier.
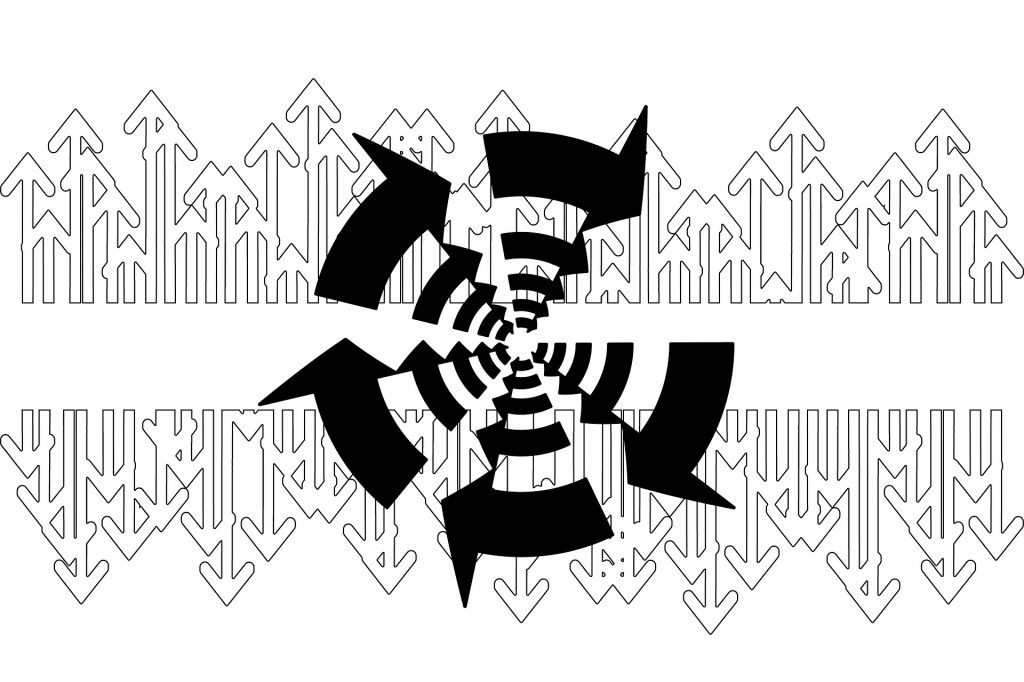 Bild: © Gerd Altmann - pixabay.com
Bild: © Gerd Altmann - pixabay.com
